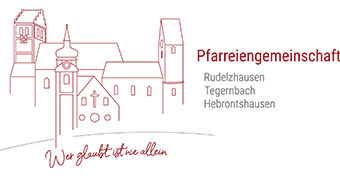12.12. Nuestra Señora de Guadalupe
Die Geschichte der Muttergottes von Guadalupe
Im Dezember des Jahres 1531, als die Sonne erst zögerlich über den Hügeln von Tepeyac aufging und der Tau noch auf den Agavenblättern glitzerte, machte sich ein einfacher Mann auf den Weg. Sein Name war Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ein friedfertiger Azteke, der sich wenige Jahre zuvor hatte taufen lassen. Er trug einen schlichten Umhang aus Maguey-Fasern – den man Tilma nennt und ging nach Tenochtitlán, um der heiligen Messe beizuwohnen.
An jenem Morgen war die Luft still, als plötzlich eine süße, melodische Stimme seinen Namen rief. Juan Diego hob den Blick und vor ihm leuchtete eine Gestalt in übernatürlicher Schönheit. Eine Frau, umhüllt von goldenem Glanz, stand auf dem Hügel. Ihr Antlitz war sanft, ihre Haut von einem warmen olivfarbenen Ton, wie die der indigenen Frauen des Landes. Der Mantel, mit funkelnden Sternen übersät, schimmerte in den Farben des Himmels über Mexiko.
„Ich bin die immerwährende Jungfrau Maria, Mutter des wahren Gottes, der alles Leben schenkt“, sprach sie in seiner Muttersprache Nahuatl. „Ich wünsche, dass an diesem Ort ein Heiligtum errichtet werde, wo ich meine Liebe und mein Erbarmen allen Menschen zeigen kann.“
Juan Diego ging sogleich zum Bischof, Fray Juan de Zumárraga, um ihre Worte zu überbringen. Der Bischof hörte ihn aufmerksam an, war jedoch unsicher so wunderbar klang diese Botschaft, dass er ein Zeichen verlangte. Beschämt und traurig kehrte Juan Diego auf den Hügel zurück. Die Jungfrau erschien ihm erneut und tröstete ihn mit mütterlicher Wärme.
Einige Tage später, am 12. Dezember, bat Maria ihn, frische Blumen vom Gipfel des Hügels zu pflücken. Es war tiefster Winter, eine Zeit, in der die Erde karg und trocken war. Doch zu seinem Erstaunen wuchsen dort rosenähnliche Blüten aus Kastilien ein Zeichen, das nur von Gott selbst stammen konnte. Er sammelte sie vorsichtig in seine Tilma und brachte sie zum Bischof.
Als er sie dort öffnete, geschah das Wunder: Während die Blumen zu Boden fielen, erschien auf dem Gewebe das Bildnis der Jungfrau, in genau jener Erscheinung, die er gesehen hatte – Maria von Guadalupe.
Die Tilma bestand aus Fasern der Agave, einem Material, das gewöhnlich nach spätestens 20 Jahren zerfällt. Doch dieses Stück Stoff ist bis heute erhalten fast 500 Jahre später. Seit Jahrhunderten steht es ohne Schutzglas, nur durch schwachen Luftstrom umgeben, im Hauptaltar der Basilika von Guadalupe in Mexiko-Stadt – und zeigt keine Anzeichen von Zersetzung.
Diese Unversehrtheit faszinierte Theologen und Naturwissenschaftler gleichermaßen. Ab dem 17. Jahrhundert begannen die ersten Untersuchungen, die im Laufe der Zeit immer präziser wurden. Trotz Kerzenrauch, Feuchtigkeit, Berührungen und Millionen von Pilgern blieb das Bild unverändert frisch.
-
1929 machte der Fotograf Alfonso Marcué bei einer offiziellen Aufnahme eine verblüffende Entdeckung: In den Pupillen der Jungfrau spiegelten sich winzige Figuren als seien sie im Moment der Offenbarung „eingraviert“.
-
1956 untersuchte der Augenarzt Dr. Javier Torroella Bueno das Bild und stellte fest, dass die Augen einer lebenden Person ähneln sie reagieren auf Lichtreflexe wie echte menschliche Augen.
-
In den 1970er Jahren führten Experten, darunter Physiker und Ingenieure der NASA, eine Reihe von Untersuchungen mit Infrarotlicht durch. Sie fanden keine Spuren von Malerei, keinen Pinselstrich, keine Pigmente, keine Grundierung. Das Bild scheint frei in den Fasern zu „schweben“, als wäre es Teil des Gewebes selbst.
-
Chemische Analysen bestätigten, dass keine bekannten tierischen oder pflanzlichen Farbstoffe verwendet wurden. Kein irdischer Ursprung konnte nachgewiesen werden.
Einer der Forscher bemerkte: „Selbst modernste Laser- oder Drucktechnologien könnten ein solches Bild heute nicht reproduzieren, erst recht nicht auf grobem Agavengewebe.“
Auch das Erhaltungsverhalten bleibt unbegreiflich: 1921 detonierte eine Bombe in unmittelbarer Nähe des Bildes. Das Glasfenster und der Altar wurden zerstört, doch die Tilma blieb völlig unversehrt – nicht einmal das Glas zersprang über dem Bild. Die winzigen Reflexionen in den Augen der Madonna zeigen – hochvergrößert – das, was Juan Diego damals sah: den Bischof, einen Dolmetscher, einen Diener und Juan Diego selbst. Niemand kennt eine Erklärung, wie sich auf einem ungemalten, flachen Gewebe mikroskopisch präzise Spiegelbilder abbilden können. Für die Wissenschaft ist es ein Rätsel. Für die Gläubigen: ein Zeichen, dass Gott selbst im Moment der Offenbarung anwesend war. Maria von Guadalupe steht im Herzen vieler Völker Amerikas als Mutter der Barmherzigkeit und Einheit. Ihr Antlitz trägt die Züge aller Menschen, nicht europäisch, nicht indigena allein, sondern das einer Frau, die Himmel und Erde verbindet.
Sie kam in einer Zeit des politischen Umbruchs nach Mexiko, kurz nach der Eroberung des Aztekenreichs, als Leid, Misstrauen und Verzweiflung herrschten. Ihr Wort und ihr Bild brachten Trost und Hoffnung. Innerhalb weniger Jahre ließen sich Millionen von Indigenen taufen nicht durch Zwang, sondern durch das Vertrauen in die „Madre del Verdadero Dios“.
Bis heute pilgern jedes Jahr über 20 Millionen Menschen zur Basilika. Manche suchen ein Wunder, andere danken in Stille. Doch alle finden etwas von jenem Licht, das einst auf dem Hügel von Tepeyac leuchtete: die Nähe des Himmels im Gewöhnlichen.
Maria von Guadalupe erinnert uns daran, dass das Göttliche nicht fern ist. Es erscheint im Staub eines Weges, im Glauben eines einfachen Herzens und – wie damals in Juan Diego – im Menschen, der bereit ist, zu hören und zu vertrauen.